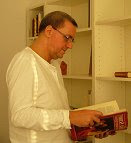Als die Nationalsozialisten vor 75 Jahren an die Macht kamen, gingen sie daran, ein „neues“, ein drittes Reich“ zu schaffen. Bei der Verhaftung von Kommunisten, Sozialdemokraten und anderen „Linken“ leisteten schwarze Listen gute Dienste, die noch während der Weimarer Republik angelegt worden und den Nazis in die Hände gefallen waren. Im April 1933 riefen die Nazis zum Boykott jüdischer Geschäfte auf, am 10. Mai schleuderten sie Bücher jüdischer und anderer Autoren in die Scheiterhaufen. Nach und nach wurden „nichtarische“ Beamte und Angestellte entlassen. Jüdischen Ärzten, Künstlern und Schriftstellern wurde die Berufsausübung verboten oder eingeschränkt. Es verging kein Tag an dem nicht massiv gegen die jüdische Bevölkerung gehetzt wurde. Dabei wurde mit ständig neuen Anschuldigungen die Behauptung Adolf Hitlers wiederholt, die Juden seien Schuld an allem Übel, und es gebe eine Weltverschwörung zwischen ihnen und den Bolschewisten. Bei den Maßnahmen konnten sich die Nazis des Beifalls eines großen Teils der Deutschen sicher sein. Dokumente belegen, dass die antijüdische Hetze und die Maßnahmen nicht nur von oben angeordnet und gelenkt wurden, sondern auch aus der Mitte der Bevölkerung massiv angeheizt wurde. Bei der Begründung der antisemitischen Politik konnte man sich auf einen prominenten Gelehrten berufen, der bereits 1879 behauptet hatte „Die Juden sind unser Unglück“. In den „Preußischen Jahrbüchern“ sprach der bekannte Berliner Historiker und Publizist Heinrich von Treitschke (1834 – 1896) jüdischen Mitbürgern das Recht ab, gleichberechtigt am Leben und der Gestaltung der Nation teilzunehmen, und riet ihnen, ihr „jüdisches Wesen“ auszuwechseln. Indem der Geschichtsprofessor für Bismarcks Einigungspolitik eintrat, erwarb er sich den Ruf eines „Herolds der Reichsgründung“. Treitschke löste mit seiner Parole eine scharfe Debatte aus, die als Berliner Antisemitismusstreit bekannt wurde. Die Nazis entwickelten später ein System praktischer Maßnahmen, die zu den so genannten Nürnberger Gesetzen von 1935 und im zweiten Weltkrieg zum Holocaust führten. Nürnberg wurde binnen Kurzem Zentrum der antijüdischen Hetze, denn hier wurde das Naziblatt „Der Stürmer“ herausgegeben. Indem das Hetzblatt Treitschkes Parole „Die Juden sind unser Unglück“ als Motto benutzte, versuchten Herausgeber Julius Streicher und Naziideologen, jene „Volksgenossen“ auf ihre Seite zu ziehen, die sich gegenüber der judenfeindlichen Politik , abwartend oder ablehnend verhielten. Ungewollt wurde Treitschke zum Wegbereiter für den Holocaust.
Heinrich von Treitschke stammte aus einer sächsischen Beamten- und Offiziersfamilie und war evangelischer Konfession. Er studierte Geschichte und Nationalökonomie in Bonn, Leipzig, Tübingen und Freiburg im Breisgau. Nach der Promotion zum Dr. iur. und seiner anschließenden Habilitation (Thema der Habilitationsschrift: "Die Gesellschaftswissenschaft. Ein kritischer Versuch" (1858)) wurde er 1863 zum außerordentlichen Professor für Staatswissenschaften in Freiburg ernannt. 1866 übernahm er eine ordentliche Professur für Geschichte und Politik an der Universität Kiel und 1867 an der Universität Heidelberg. 1873 wurde er als Nachfolger auf den Lehrstuhl Leopold von Rankes an die Universität der Hauptstadt des Deutschen Reiches berufen. Von Treitschke stammt der Satz „Die Juden sind unser Unglück“, der später das Schlagwort des nationalsozialistischen Hetzblattes „Der Stürmer“ wurde. Treitschke formulierte diesen Satz in dem Aufsehen erregenden Aufsatz „Unsere Aussichten“ (1879) als angeblichen parteiübergreifenden Konsens seiner Zeitgenossen „wie aus einem Munde" und erhob darin Forderungen nach Zurückdrängen des gesellschaftlichen Einflusses der Juden. Der Aufsatz löste den Berliner Antisemitismusstreit aus, der die deutsche Öffentlichkeit landesweit beschäftigte, bis 1881 anhielt und den Antisemitismus gesellschaftsfähig machte. Der Kern der Polemik Treitschkes ist gegen den Willen der Juden gerichtet, ihre eigene Identität und ihren kulturellen Zusammenhang zu behaupten, während sie an dem Leben der Nation teilnehmen können. Der Weg der Assimilation, den er für eine Lösung hielt, sei von einzelnen wie Gabriel Rießer und Felix Mendelssohn schon betreten worden. In seiner politischen Theorie ging er davon aus, dass ein Jude, der den Willen zur vollen Bejahung seiner Umwelt habe, die Fähigkeit besitze, deutsches Wesen in sich aufzunehmen und das jüdische Wesen abzustreifen. Eine Bekehrung zum Deutschtum mit allen seinen spirituellen Werten sei möglich. Alles, was an Gutem an den Juden sei, wäre aus der Anpassung an die deutsche Welt geschöpft, das Judentum selbst sei keine positive Kraft, sondern ein überlebtes Relikt mit der gefährlichen Kraft, eine säkularisierte internationale Gesellschaft zu bilden. Die gesunde Haupttendenz der Geschichte läge im modernen Nationalstaat mit christlicher Tradition. Das Judentum dürfe nie gleichberechtigte Konfession werden, da sonst keine nationale Einheit möglich sei und nur die Vertreibung aller Juden bliebe. Die Rassenlehre als Grundlage der Nationalidee, die damals Antisemiten wie Wilhelm Marr und bald darauf Karl Eugen Dühring propagierten, lehnte Treitschke ab; aber auch er sprach von „Blutvermischung" und „Mischkultur" als „zersetzendem" Faktor, auf den das gesunde germanische Volksempfinden mit Abwehr reagieren müsse. Die damals verbreitete Antisemitenpetition hat er nicht unterschrieben, stand den Aktionen seiner Studenten zur Unterschriftensammlung aber wohlwollend gegenüber und distanzierte sich erst auf Drängen seines Kollegen Theodor Mommsen davon (November 1880). Seine Schriften und Vorlesungen an der Berliner Universität haben erheblich dazu beigetragen, in der gebildeten Welt eine Betrachtungsweise einzuführen, durch die das Judentum der nationalen Einigung wesensfremd erschien. Treitschke grenzte sich zwar vom „Radau-Antisemitismus" ab, sah diesen aber als berechtigte Folge des angeblich übergroßen Einflusses der Juden an. Er sah sich aber selbst nicht als Antisemiten und verwies auf seine Kontakte zu Juden (z.B. hielt er die Grabrede auf seinen jüdischen Bundesbruder Oppenheim). Seine Schriften waren jedoch radikal nationalistisch, wobei sein Verständnis von Nation die Juden als Fremde sah und ausgrenzte. Der Historiker Golo Mann charakterisierte Treitschkes Haltung wie folgt: „Zugleich mit der Judenemanzipation, der neuen bürgerlichen Angleichung, erscheint der neue Antisemitismus. Aber er ist zunächst nicht das, was wir uns darunter vorstellen; er verlangt nicht Ausschließung, sondern völlige Angleichung und Bescheidenheit in der Angleichung; er verlangt Ausschließung nur derer, die sich nicht angleichen wollen. Ich will Ihnen für diese Ansicht, diese Haltung nur ein merkwürdiges Beispiel geben, das des deutschen Historikers Heinrich von Treitschke. Dieser große Schriftsteller gilt gemeinhin als Antisemit, und das war er auch; dennoch hätten etwa die Nazis mit seinem Antisemitismus durchaus nichts anfangen können. Treitschke war ein leidenschaftlicher, zorniger Patriot, sehr entschieden in seinem Urteil, aber mit einem schönen Sinn für das Gerechte und Wahre; etwas Unwahres, etwas Gemeines wäre nie aus seiner Feder gekommen. Und so sah Treitschke nur eine mögliche Lösung der Judenfrage in Deutschland: völliges Aufgehen des zahlenmäßig so geringen Judentums im Deutschtum, Preisgabe jedes eigenen jüdischen Lebensstiles. Er lobte die preußischen Juden, die in den Befreiungskriegen ehrenhaft ihre soldatische Pflicht getan hatten.“