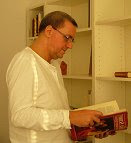Bayern verbietet Nachdruck von Nazi-Zeitungen
Juristischer Ärger für das Geschichtsprojekt "Zeitungszeugen": Bayerns Finanzministerium untersagt der Zeitschrift den Abdruck von Nazi-Zeitungen - und zwar, weil der Freistaat die Rechte daran hält. Jetzt sollen sogar bereits veröffentlichte Exemplare eingezogen werden.
Was haben die Deutschen zwischen 1933 und 1945 in den Zeitungen gelesen? Und was können wir heute zwischen den Zeilen der NS-Blätter lesen? Mit diesen Fragen wirbt das Zeitschriftenprojekt "Zeitungszeugen": Ein Nachdruck von historischen Texten und Artikeln aus der Zeit des Nationalsozialismus - Nazi-Presse und Blätter politischer Gegner im Original. Startauflage: 300.000. Der ersten Ausgabe in der vergangenen Woche wurde ein Druck der einst im Münchner Eher-Verlag erschienenen Zeitung "Der Angriff" beigelegt, in der Ausgabe vom 30. Januar 1933. Schlagzeile: "Reichskanzler Hitler." Herausgeber: Joseph Goebbels, der spätere Propagandaminister. Für die nächsten "Zeitungszeugen" ist der "Völkische Beobachter", die einstige NSDAP-Parteizeitung, angekündigt. Doch soweit soll es nicht kommen - wenn es nach Bayerns Finanzministerium geht. Man habe "untersagt, dass im Rahmen der Zeitung 'Zeitungszeugen' nationalsozialistische Zeitungen veröffentlicht werden", teilte das Ministerium SPIEGEL ONLINE mit. Der Hintergrund: Nach Kriegsende ging das gesamte Vermögen des Eher-Verlags inklusive der Lizenzrechte für die NS-Blätter auf den Freistaat Bayern über. Die entsprechende Zuständigkeit dafür obliegt bis heute dem Finanzministerium in München. Dieses betreibt seit Jahren eine restriktive Politik und untersagt Abdruckgenehmigungen im In- und Ausland. Dies geschehe zum einen aus Respekt vor den Opfern des Holocaust, für die Neuveröffentlichungen immer wieder einen Affront und eine Konfrontation mit ihren Leiden darstellten. Zum anderen wolle man einer weiteren Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts vorbeugen, so das Ministerium. Nun sollen die bereits erschienenen Exemplare der ersten "Zeitungszeugen"-Ausgabe wieder eingezogen werden. Außerdem forderte das Finanzministerium die Initiatoren - das britische Verlagshaus Albertas Limited - auf, eine entsprechende Unterlassungserklärungen abzugeben. Die "Zeitungszeugen"-Chefredakteurin Sandra Paweronschitz sagte zu SPIEGEL ONLINE, dass sie "mit diesem Fall gerechnet" habe. Man teile jedoch nicht die Meinung des bayerischen Finanzministeriums und habe es daher auch nicht vorab wegen der Urheberrechte kontaktiert. Vorerst gehe man davon aus, dass "Zeitungszeugen" nicht aus dem Verkauf genommen werden müsse. Eine Stellungnahme des Verlags sei bei Gericht bereits eingereicht. Vermutlich müsse ein Rechtsstreit geführt werden. Es sei ein fundamentaler Unterschied, ob eine NS-Zeitung einfach so wiederveröffentlicht werde oder, wie in "Zeitungszeugen", als historische Quelle gezeigt und eingeordnet werde. Zu den juristischen Aspekten des Streits wollte sich Paweronschitz im Detail aber nicht äußern. Derzeit prüfe ein Anwalt die Lage, sagte die Chefredakteurin. "Zeitungszeugen"-Verleger Peter McGee wies die rechtlichen Ansprüche der Staatsregierung zurück. "Entgegen den Behauptungen des bayerischen Finanzministeriums ist völlig unklar, ob dem Freistaat die ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte an den NS-Blättern 'Angriff' oder dem 'Völkischen Beobachter' jemals zugestanden haben. Und wenn ja, bleibt fraglich, ob diese Rechte 70 Jahre nach der Veröffentlichung überhaupt noch in Bayern liegen", sagte McGee und kündigte an: "Wir werden dies gerichtlich klären lassen." Das Zeitungsprojekt "Zeitungszeugen" hat einen Expertenbeirat. Prominentestes Mitglied ist der Leiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung, Wolfgang Benz. Der Historiker zeigte sich gegenüber SPIEGEL ONLINE nicht gänzlich überrascht von der Vorgehensweise des bayerischen Finanzministeriums: "Dass es mit München schwierig werden könnte, sofern es um den Nachdruck aus dem Eher-Verlag geht, war der Redaktion, so glaube ich, bewusst." Benz verweist aber auf das österreichische Vorläuferprojekt des Verlags im vergangenen Jahr. Dort wurde der "Völkische Beobachter" ebenfalls nachgedruckt. "Ich wundere mich, dass das Finanzministerium in München darauf offenbar gelassen reagierte, denn auf meinem Schreibtisch liegt die faksimilierte Ausgabe des Völkischen Beobachters vom 15. Juni 1940. Soweit mir bekannt, gab es dazu keine Reaktionen", so Benz. Der Historiker verteidigte das Projekt, auch NS-Zeitungen nachzudrucken: "Wahrscheinlich werden in einer Stunde Guido Knopp über die NS-Zeit im ZDF mehr Filmausschnitte aus dem Dritten Reich und Symbole frei Haus an ein Millionenpublikum gesendet als in einem historisch und fachlich begleiteten Faksimileprojekt." Ausdrücklich hätten sich Beirat und Redaktion im Vorfeld darauf geeinigt, keine Ausgaben des antisemitischen Hetzblatts "Der Stürmer" nachzudrucken. Zudem verweist Benz darauf, dass nicht nur NS-Zeitungen nachgedruckt werden. "Es war immer beabsichtigt, ein breites Spektrum darzustellen. Natürlich wird das, je länger die NS-Zeit andauerte, schwieriger." So habe man sich auch darauf verständigt, Ausgaben der deutschen Exilpresse, der Presse des Saarlands (bis zum Anschluss ans Deutsche Reich 1935) und der ersten deutschen Ausgaben unter alliierter Kontrolle 1944/45 nachzudrucken. Benz ist überzeugt, dass das Projekt auch ohne die Erzeugnisse des Eher-Verlags weitergeführt werden kann. So habe etwa die "Frankfurter Zeitung" bis 1943 bestanden. "Ohne die Faksimiles aus dem Eher-Verlag wird das Rückgrat nicht gebrochen", so Benz. In Bayern unterdessen steht auch Koalitionspartner FDP hinter der Entscheidung des CSU-geführten Finanzministeriums. "Urheberrechtlich ist das korrekt", sagt Andreas Fischer, der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion zu SPIEGEL ONLINE. Auch in der Abwägung von wissenschaftlichen Interessen auf der einen und möglichen Risiken auf der anderen Seite unterstütze er das Ministerium: "Gerade vor dem Hintergrund, dass Rechtsextremisten diese Nachdrucke missbrauchen könnten, sollten wir das restriktiv handhaben", so Fischer. Für Wissenschaftler sei es zudem möglich, in Bibliotheken zu forschen. Bayern hält auch die Rechte an Hitlers Hetzschrift "Mein Kampf" - allerdings nur noch bis zum Jahr 2015. In dem Jahr - 70 Jahre nach Hitlers Selbstmord - läuft der Urheberschutz für das Buch aus. Bisher lehnt die bayerische Regierung eine wissenschaftlich kommentierte Ausgabe ab.
Mit Material von ddp und dpa
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,601693,00.html