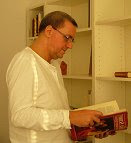Freispruch 1993
Er war zum Tode verurteilt und kam davon: Vor mehr als 20 Jahren stand John Demjanjuk in Israel vor Gericht. Doch am Ende des Verfahrens wurde jener Mann, dem jetzt in Deutschland wieder der Prozess gemacht werden soll, freigesprochen. Die Geschichte eines spektakulären Ermittlungsfehlers. Von Cordula Meyer und Axel Frohn
Die Richter hatten gerade erst ihr Urteil verkündet, da feiern die Israelis im Gerichtssaal schon frenetisch: "Tod, Tod, Tod!", rufen Teenager rhythmisch: Für sie gibt es keinen Zweifel: Der Mann vor ihnen auf der Anklagebank ist ein Massenmörder, ein Schlächter, "Iwan der Schreckliche", verantwortlich für den Tod tausender Juden im Zweiten Weltkrieg. Der Mann, dessen Todesurteil für so viel Freude sorgt, heißt John Demjanjuk. Kurz nach dem Urteil wird der Galgen für ihn gebaut.
Die Richter hatten gerade erst ihr Urteil verkündet, da feiern die Israelis im Gerichtssaal schon frenetisch: "Tod, Tod, Tod!", rufen Teenager rhythmisch: Für sie gibt es keinen Zweifel: Der Mann vor ihnen auf der Anklagebank ist ein Massenmörder, ein Schlächter, "Iwan der Schreckliche", verantwortlich für den Tod tausender Juden im Zweiten Weltkrieg. Der Mann, dessen Todesurteil für so viel Freude sorgt, heißt John Demjanjuk. Kurz nach dem Urteil wird der Galgen für ihn gebaut.
Das war 1988 - vor mehr als 20 Jahren. John Demjanjuk lebt immer noch - und sorgt seit Monaten erneut für viel Wirbel. Nach langem Rechtsstreit wurde er jetzt aus den USA nach Deutschland geflogen, die Münchner Staatsanwaltschaft will ihm den Prozess machen - wegen Beihilfe zum Mord in 29.000 Fällen. So viele Menschen wurden im Vernichtungslager Sobibor ermordet, während Demjanjuk dort als Wachmann Dienst getan habe, so die Strafverfolger.
Doch in der in der medialen Aufregung um seine Auslieferung nach Deutschland ist der erste Prozess gegen Demjanjuk fast völlig in Vergessenheit geraten. Dabei zeigt er, wie schwierig es werden könnte, Demjanjuk zu verurteilen. Der saß in Israel sieben Jahre in einer Zelle - und sollte das Land dennoch als freier Mann verlassen.
Schwere Ermittlungsfehler, Irrtümer, unterdrückte Beweise
Die Wurzeln für diesen völlig überraschenden Ausgang, der damals für Israel zum Fiasko wurde, gehen bis in die siebziger Jahre zurück. Seit mehr als drei Jahrzehnten sind Nazi-Jäger dem heute 89-Jährigen auf der Spur. Sie ließen nicht locker - aber während dieser Zeit machten die Ermittler auch schwere Fehler, erlagen Irrtümern, und das US-Justizministerium unterdrückte sogar entscheidende Beweise.
Der erste Hinweis auf Demjanjuk stammt von einem seiner ehemaligen Kollegen. Ignat Daniltschenko, auch ein KZ-Wachmann, hatte bei seinem eigenen Kriegsverbrecherprozess in der Sowjetunion ausgesagt, er kenne einen Iwan Demjanjuk, der mit ihm zusammen in Sobibor und Flossenbürg Dienst getan habe. Die Amerikaner forschten nach und fanden Demjanjuks Einwanderungsakte: Als seinen Aufenthaltsort im Krieg hatte er "Sobibor" eingetragen - Standort eines Vernichtungslagers. Die US-Ermittler wurden hellhörig, aber mehr Indizien fanden sie nicht. Kein Sobibor-Überlebender in den USA konnte Demjanjuks Foto identifizieren. Also schickten die Kriminalisten das Foto mit 16 anderen Fotos verdächtiger Ukrainer nach Israel, damit sie KZ-Überlebenden vorgelegt werden konnten.
Per Zeitungsanzeige suchte die israelische Chef-Ermittlerin nach Zeugen aus den Todeslagern Sobibor und Treblinka. Keiner der Sobibor-Überlebenden erkannte ihn - allerdings ein Zeuge aus einem anderen Vernichtungslager, Abraham Goldfarb. "Iwan", sagte der Überlebende aus Treblinka und zeigte spontan auf das Foto mit der Nummer 16. "Aus wenigen Metern Entfernung" habe er gesehen, wie dieser Wachmann, "mit Eisenstangen und einem Bajonett", die Opfer in die Gaskammern trieb. "Wir Arbeiter nannten ihn Iwan Grozny, Iwan den Schrecklichen." Am Ende hat Israel sechs Augenzeugen, die auf Demjanjuks Foto "Iwan den Schrecklichen" aus Treblinka zu erkennen glaubten. Einen Mann, der Frauen auf dem Weg in die Gaskammer mit einem Bajonett die Brüste abschnitt. Eine mordlustige, meuchelnde Bestie. Einen Mann, der die Dieselmotoren für die Gaskammern anwarf, viele der 900 000 Treblinka-Toten mit eigenen Händen mordete.
Nichts darf den prestigeträchtige Fall kaputt machen
1977 wird in den USA ein Verfahren eingeleitet, um Demjanjuk die US-Staatsangehörigkeit zu entziehen. Das stärkste Beweismittel sind die ergreifenden Aussagen der Augenzeugen aus Treblinka. Außerdem findet die neugegründete Nazijäger-Einheit Office og Special Investigations (OSI) im US-Justizministerium einen Dienstausweis mit Demjanjuks Daten, der dessen Dienst als KZ-Wachmann bestätigt - aber eben in Sobibor und Flossenbürg, nicht in Treblinka. Um die Widersprüche auszuräumen, lässt das OSI sogar Demjanjuks mutmaßlichen Kollegen Daniltschenko durch sowjetische Beamte noch einmal vernehmen. Doch der verstärkt die Widersprüche noch und bleibt dabei, fast zwei Jahre zusammen mit Demjanjuk in Sobibor und Flossenbürg gewesen zu sein.
Die US-Nazi-Jäger vom OSI haben nun ein Problem. Die Treblinka-Überlebenden beteuern, Demjanjuk sei zur selben Zeit in Treblinka gewesen in der Daniltschenko mit ihm in Sobibor und Flossenbürg zusammen gearbeitet haben will. Die Geschichten passen nicht zusammen. Ein besonders penibler Ermittler, George Parker, schreibt seine Zweifel in einem langen Aktenvermerk an seine Chefs auf. Er nimmt an, dass die Augenzeugen sich geirrt haben müssen. "Selbst wenn es uns beruhigt, dass wir den richtigen Mann für die falsche Sache haben", schreibt Parker, "müssen wir aus ethischen Gründen unsere Position ändern." Der Fall müsse "radikal umgebaut" oder fallen gelassen werden.
Doch die Ermittler wollen sich den prestigeträchtigen Fall nicht kaputtmachen lassen. Sie ignorieren Parker, machen passend, was nicht passt und ersinnen eine "Transfer-Theorie": Demjanjuk sei zwischen den knapp 200 Kilometer entfernten Lagern Treblinka und Sobibor hin- und hergependelt. Im Juni 1981 wird Demjanjuk die US-Staatsbürgerschaft aberkannt. Zur gleichen Zeit verhandeln US-Beamte mit israelischen Kollegen allgemein über die Auslieferung von Nazi-Kriegsverbrechern. Sie sind sich einig, dass der Kandidat für ein erstes Verfahren "sehr sorgfältig ausgesucht" werden müsse. Die Israelis sind nicht an einem zweiten Eichmann-Prozess interessiert. Sie wollen diesmal keinen Vernichtungsbürokraten, für den zweiten Prozess in Israel soll ein Schlächter vor den Richter. Einer, der mit eigenen Händen gemordet hat. Demjanjuk scheint ideal.
Hunger, Schläge, Tod im Vernichtungslager
Im Februar 1987 beginnt der Prozess gegen ihn in einem Jerusalemer Theater. Jeder Gerichtssaal wäre zu klein. Schulklassen kommen in Bussen zur Verhandlung. Als die Überlebenden aussagen, wird ihr Auftritt auf Monitoren vor dem Gerichtssall übertragen. Die Zeugen erzählen vom unfassbaren Horror des Vernichtungslagers, vom Hunger, von den Schlägen und vom Tod überall. Ein Opfer geht ganz nah an Demjanjuk heran und sieht ihm direkt in die Augen. "Das ist Iwan", sagte er. "Ich sage es ohne den geringsten Zweifel."
Die Israelis wissen bis dahin nichts von Daniltschenkos Aussage, sie wissen nichts von den Zweifeln George Parkers. Aber sie haben den Dienstausweis Demjanjuks, in dem Sobibor verzeichnet ist. Der Staatsanwalt Michael Shaked wedelt sogar mit dem Dienstausweis in einer Klarsichthülle herum. Shaked versucht den Rentner klarzumachen, dass es ihn vor den Treblinka-Vorwürfen retten könnte, wenn er zugibt, in Sobibor gewesen zu sein. Doch Demjanjuk bleibt bei seiner Aussage, er sei Kriegsgefangener gewesen, unter anderem 18 Monate in einem Lager in Chelm - bis die Deutschen ihn für eine Kampfeinheit bei Graz angeheuert hätten. 1988 verurteilt ihn das israelische Gericht zum Tod durch den Strang - und löst damit den verfrühten Jubel aus.
Denn Demjanjuk geht in die Revision - und wird durch eine Kette von Zufällen gerettet. Erst stürzt einer von Demjanjuks Verteidigern von einem Hochhaus und stirbt, dann schüttet dem zweiten Verteidiger ein Holocaust-Überlebender Säure ins Gesicht. Nur knapp kann dessen Augenlicht gerettet werden. Während der sich von dem Attentat erholt, gewinnt Demjanjuk wertvolle Zeit - etwa anderthalb Jahre. In dieser Zeit fällt der Eiserne Vorhang, auf einmal sind ganz neue Recherchen möglich. "Mir ist klar, dass ohne das Material aus der Sowjetunion Demjanjuk exekutiert worden wäre", sagte Demjanjuk Verteidiger damals.
Identisch bis auf die Haarfarbe
Am Ende sind es Journalisten, Demjanjuks Angehörige, sowie der israelische Staatsanwalt selbst, die eine neue Wahrheit ans Licht bringen. Ein US-Reporter findet eine Maria Dudek in einem Dorf bei Treblinka, die berichtet, mit dem schrecklichen Iwan geschlafen zu haben, dem Betreiber der Gaskammern von Treblinka. Sein Name sei Iwan Martschenko, mit schwarzem Haar. Demjanjuk aber hat dunkelblondes Haar. Journalisten finden außerdem eine polnische Liste mit 43 Namen von Treblinka-Wächtern. Demjanjuk ist nicht dabei. Aber Martschenko. Demjanjuks Schwiegersohn treibt ein Hochzeitsfoto von Martschenko auf; es wird zum Beweismittel, denn Martschenko sieht Demjanjuk bis auf die Haarfarbe ähnlich. Dann tauchen noch Aussagen von mehr als 20 Wachmännern und Zwangsarbeiterinnen auf, die Iwan Martschenko als Betreiber der Gaskammer identifizierten.
Nach all dem weiß der israelische Staatsanwalt Michael Shaked, dass er selber nachermitteln muss. Er recherchiert in russischen und in deutschen Archiven. Als er nach Israel heimkehrt, hat er im Gepäck Aussagen von 37 Zeugen, die Martschenko als den Operateur der Gaskammern in Treblinka identifizieren. Dazu hat Shaked eine Kopie von Marchenkos Personalbogen und weiß, dass der KGB lange nach ihm als Kriegsverbrecher gesucht hatte. Es spricht alles dafür, dass Marchenko der berüchtigte "Iwan der Schreckliche" war. Und Demjanjuk? Für seinen Aufenthalt in Treblinka gibt es keine Hinweise. Auch die Kommandanten des Lagers können sich nicht an ihn erinnern. Aber für Demjanjuks Rolle in Sobibor hat Shaked neue Indizien gefunden. Viele davon sollen nun auch in München als Beweismittel dienen.
Shaked versucht nun, Demjanjuk wegen seiner mutmaßlichen Taten in Sobibor zur Verantwortung zu ziehen: "Wenn dieser Mann auch nur ein Kind in die Gaskammer geschoben hat, besteht irgendein Zweifel daran, ob er zur Verantwortung gezogen werden muss?" Aber das Revisionsgericht lehnt ab, Demjanjuk wegen Sobibor zu verurteilen - letztlich eine politische Entscheidung: Der israelische Generalstaatsanwalt wollte kein neues Verfahren führen, der Oberste Gerichtshof stützt diesen Kurs. Das wichtigste Argument: Niemand dürfe wegen derselben Sache zwei Mal angeklagt werden - und Sobibor sei auch Teil des ersten Prozesses gewesen.
Der vorsitzende Richter des Obersten Gerichtshofs ließ zwar durchblicken, dass er es für wahrscheinlich halte, dass Demjanjuk "Hilfswilliger" der Nazis war. Aber: "Wachmann gewesen zu sein, ist nicht das Verbrechen", sagte er. "Sondern Völkermord."
Demjanjuk wird freigesprochen und verlässt am 22. September 1993 Israel an Bord einer El Al-Maschine in der Business Class. 1998 erhält er seine US-Staatsangehörigkeit zurück. Ein Foto aus dem Flugzeug von Israel zurück in die USA hat sich Demjanjuks Sohn John rahmen lassen. Es steht heute in seinem Büro.
© SPIEGEL ONLINE 2008