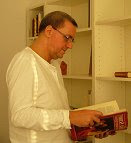Nazis in Palästina
Das Gelobte Land eine Nazi-Hochburg? Genau. Vor 1939 war jeder dritte deutsche Siedler in Palästina Mitglied der NSDAP, die Hitler-Jugend von Haifa bot Hebräisch-Kurse an. Nach dem Krieg mussten die Palästina-Deutschen weichen - und wurden von Israel finanziell entschädigt. Von Ralf Balke
Es war eine der unzähligen blutigen Saalschlachten zwischen Kommunisten und Nazis gegen Ende der Weimarer Republik, die 1932 im württembergischen Nagold stattfand. "Ich wurde Zeuge, wie ein befreundeter SA-Mann durch einen Revolverschuss schwer verletzt wurde", erinnerte sich Ludwig Buchhalter später an das dramatische Ereignis, das ihn nachhaltig prägen sollte: Kurz nach dem Zwischenfall trat der politisch unbedarfte junge Mann der NSDAP bei.
Es war eine der unzähligen blutigen Saalschlachten zwischen Kommunisten und Nazis gegen Ende der Weimarer Republik, die 1932 im württembergischen Nagold stattfand. "Ich wurde Zeuge, wie ein befreundeter SA-Mann durch einen Revolverschuss schwer verletzt wurde", erinnerte sich Ludwig Buchhalter später an das dramatische Ereignis, das ihn nachhaltig prägen sollte: Kurz nach dem Zwischenfall trat der politisch unbedarfte junge Mann der NSDAP bei.
Eigentlich nichts Besonderes, schließlich taten das damals Hunderttausende von Deutschen. Und doch beinhaltet der Fall eine gewisse Pikanterie, denn Ludwig Buchhalter stammte aus Jerusalem. Und dorthin kehrte er nach seiner Ausbildung in Nagold 1933 auch zurück, nahm eine Stelle als Lehrer an der Deutschen Schule an. Nur wenig später wurde er Ortsgruppenleiter der NSDAP in Jerusalem.
Die NSDAP-Ortsgruppe in Jerusalem war Teil eines nationalsozialistischen Netzwerks im Heiligen Land, das bald unter der Bezeichnung "Landesgruppe der NSDAP in Palästina" firmieren sollte. Und wie in Jerusalem rekrutierte sich die Mehrheit ihrer Mitglieder aus der "Tempelgesellschaft", einer pietistischen Abspaltung der württembergischen Landeskirche. Deren schwäbische Anhängerschaft hatte sich gegen Mitte des 19. Jahrhunderts die "Errichtung des Reichs Gottes auf Erden" auf ihre Fahnen geschrieben, das sie natürlich nirgendwo anders aufzubauen gedachten, als im Heiligen Land selbst. 1868 begann die Übersiedlung der ersten Templer in die damalige osmanische Provinz Palästina.
"Blut, Boden, Rasse als gottgeschenkte Wirklichkeiten"
Zu Beginn der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts zählte die Palästina-deutsche Minorität knapp zweieinhalbtausend Personen. Die schwäbischen Siedler lebten strikt abgeschottet von allen Nicht-Deutschen. Mit einer gehörigen Portion Chauvinismus blickten sie auf die Araber herab, die für sie nur "das Brot der Faulheit" aßen. Und voller Missgunst betrachteten sie den Erfolg der Zionisten, der ihre Hoffnungen zunichte machte, selbst irgendwann einmal das Land zu beherrschen.
In ihren Augen war die zionistisch motivierte Einwanderung nur durch die "Macht des jüdischen Goldes" zu Einfluss zustande gekommen. Schon frühzeitig wurde der ursprünglich religiös motivierte Antijudaismus der Templer durch Anspielungen auf die unerschöpfliche Finanzkraft eines angeblich omnipotenten "Weltjudentums" ersetzt und später durch rassebiologische Antisemitismus angereichert. Stolz verkündete 1935 die "Warte des Tempels", das Zentralorgan der Tempelgesellschaft, dass man sich seit Generationen "in der Rassenfrage ganz im nationalsozialistischen Sinne verhalten" habe. "Blut, Boden, Rasse als gottgeschenkte Wirklichkeiten", lautete bald das Credo der Pietisten.
Wie die Biographie Ludwig Buchhalters zeigt, leitete das Jahr 1933 eine für die Palästina-Deutschen verhängnisvolle Wende ein. Die Hitler-Diktatur verstanden sie als Beginn einer Renaissance Deutschlands; die deutschen Siedler ergriff eine bis dahin unbekannte Politisierung. Schon 1932 hatte Karl Ruff, ein in Haifa ansässiger Architekt, erste Kontakte zur Nazi-Partei geknüpft. Die Auslands-Organisation (AO) der NSDAP, zuständig für die Mitglieder der Partei jenseits der Reichsgrenzen, reagierte prompt und hoffte, "besonders in Palästina eine Landesgruppe ins Leben rufen" zu können.
Braunes Palästina
Das Ergebnis war zunächst eher mager. Gerade sechs Palästina-Deutsche beantragten vor 1933 das braune Parteibuch. Aber bereits im November 1933 waren 42 Mitglieder registriert, und im Januar 1938 war die Zahl auf über 330 angewachsen: Jeder dritte erwachsene Deutsche in Palästina war damit NSDAP-Mitglied. Ein Spitzenwert: Während insgesamt nur fünf Prozent der im Ausland lebenden deutschen Staatsbürger Parteigenossen waren, lag der Anteil in Palästina bei rund 17 Prozent.
Am Charisma der lokalen Parteifunktionäre lag es auf keinen Fall, dass es mit der NSDAP in Palästina so rasant aufwärts ging. Genau wie ihre großen Vorbilder daheim im "Dritten Reich" legten die braunen Würdenträger einen ausgesprochenen Hang zu Intrigen und gegenseitigen Denunziationen an den Tag, der die Parteiarbeit eher lähmte. Aber dennoch: "Es ist schon eine ganze nette Hitlergemeinde hier, welche regelmäßig zu den Reden kommt", schrieb der spätere NSDAP-Landesgruppenleiter Cornelius Schwarz seinem Sohn Erwin im März 1933 nach Kairo, "auch kommen immer junge Leute, die auch schon begeistert sind."
In nur wenigen Jahren etablierten sich in jeder deutschen Siedlung im gelobten Land Ortsgruppen der NSDAP. Sehr erfolgreich kopierten die Palästina-Deutschen zudem das im "Dritten Reich" eingeführte Spektrum an NS-Organisationen. Viele Details aus dem Palästina-deutschen Alltag unter dem Hakenkreuz erscheinen aus heutiger Sicht bizarr - etwa die von der Hitler-Jugend Haifa angebotenen Hebräisch-Sprachkurse.
Juden mit Hakenkreuzfahnen
Die Selbstgleichschaltung der Deutschen in Palästina war überaus erfolgreich und ging absolut freiwillig über die Bühne. Im Unterschied zu Deutschland verfügte die Palästina-NSDAP über keinen Repressionsapparat - niemand, der sich den Jerusalemer Nazis widersetzt hätte, wäre an Leib und Leben gefährdet gewesen. Die unwidersprochene, auf keinerlei Gegenkraft stoßende Gleichschaltung der Palästina-Deutschen lässt sich daher treffend als "Selbstnazifizierung" charakterisieren.
Die Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges boten so gelegentlich Szenen wie aus einem absurden Theaterstück an. So forderten die Araber in den Unruhejahren zwischen 1936 und 1939 beim Passieren der von ihnen kontrollierten Gebiete explizit die Hakenkreuzfahne als Erkennungszeichen an deutschen Autos, um Verwechslungen mit Juden oder Briten zu vermeiden. Und die eigentlich recht elitäre NSDAP empfahl allen Palästina-Deutschen, das Hakenkreuzabzeichen zu tragen - ganz unabhängig davon, ob sie Parteimitglied waren oder nicht.
Diese Ausnahmesituation wiederum hatte zur Folge, dass die britische Mandatsmacht wie die jüdischen Bewohner Palästinas die Deutschen pauschal der Nähe zu den aufständischen Arabern verdächtigten. Ludwig Buchhalter bekam dies hautnah zu spüren, als er auf einer Fahrt von Jerusalem nach Jaffa dank einer Hakenkreuzfahne am Wagen zwar die arabischen Dörfer ungehindert durchfahren konnte, dann aber aus einem jüdischen Fahrzeug unter Feuer genommen wurde. Auch der tägliche, zwischen Jerusalem und der deutschen Siedlung Wilhelma pendelnde Molkereiwagen führte eine Hakenkreuzfahne mit - die dann schon mal von den gelegentlich mitfahrenden jüdischen Passagieren geschwenkt werden musste.
Israel muss Alt-Nazis entschädigen
Der Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 bedeutete das Aus für die deutschen Siedlungen in Palästina - und damit auch für die NSDAP-Landesgruppe. Ein Teil der wehrpflichtigen Deutschen, unter ihnen auch der Jerusalemer Ortsgruppenleiter Buchhalter, konnten noch unmittelbar vor Ausbruch der Kampfhandlungen per Seeweg aus dem Gelobten Land fliehen. Die übrigen Palästina-Deutschen wurden kurzfristig verhaftet, durften aber nach wenigen Wochen in ihre Häuser zurückkehren.
Als jedoch "Wüstenfuchs" Erwin Rommel und sein Afrika-Korps entlang der Mittelmeerküste nach Osten vorstießen, verschifften die Briten über 500 verbliebene Palästina-Deutsche nach Australien. Dort wurden sie in einem Internierungslager untergebracht, wo sie noch im April 1945 voller Hoffnung auf den Endsieg im Outback Hitlers Geburtstag feierten.
Das offene Bekenntnis der Palästina-Deutschen zum Nationalsozialismus rächte sich nach 1945 bitter. Eine Rückkehr der deutschen Siedler war unmöglich geworden, die noch verbliebenen mussten bis zur Gründung des Staates Israels 1948 das Land verlassen. Die Tempelgesellschaft verlor damit den Mittelpunkt ihres religiösen und sozialen Lebens; ihre Anhänger lebten fortan nur noch in Deutschland und Australien.
Der Abschied von der alten Heimat im Heiligen Land wurde den Ex-Nazis und braunen Mitläufern allerdings durch finanzielle Entschädigung erleichtert: Israel musste 54 Millionen D-Mark aus den bundesdeutschen Zahlungen als Entschädigung für das konfiszierte Palästina-deutsche Eigentum verwenden - das jedenfalls sah eine Passage in dem sogenannten Wiedergutmachungsabkommen zwischen dem jüdischen Staat und der Bundesrepublik Deutschland vor. Auch der einstige NSDAP-Ortgruppenleiter von Jerusalem, Ludwig Buchhalter, profitierte davon. Für sein verlorenes Haus in Jerusalem wurde der bis zu seiner Pensionierung 1975 im Schuldienst Baden-Württembergs tätige Lehrer in den fünfziger Jahren mit einem fünfstelligen Betrag fürstlich entschädigt.
© SPIEGEL ONLINE 2008